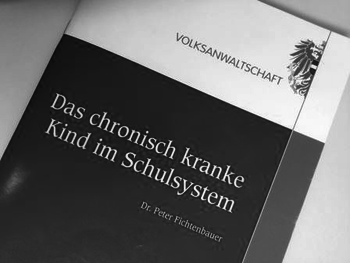Gleiche Rechte für chronisch kranke Kinder
Von Peter Fichtenbauer
In Österreich sind etwa 190.000 Kinder von chronischen Erkrankungen betroffen. Experten weisen drauf hin, dass die Erkrankungen zunehmen, so tritt beispielsweise Diabetes des Typs A bei immer mehr Menschen im Kindesalter auf. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt, unumgänglich ist aber, dass die Gesellschaft auf diese Situation reagieren muss. Kinder mit chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes, Asthma, Epilepsie oder Mukoviszidose können und dürfen von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht ausgeschlossen oder durch bürokratische Hürden daran gehindert werden. Für die Kinder und deren Familien ist der Umgang mit der Erkrankung eine große Aufgabe, die aber besonders von den Kindern selbst oft hervorragend bewältigt wird. Sie werden regelrecht zu kleinen Spezialisten bei der Bewältigung des Alltags und der medizinischen Notwendigkeiten. Auch die Eltern und Geschwister können zumeist sehr gut mit der Erkrankung umgehen, sodass für die Kinder, solange sie im familiären Umfeld sind, kaum auffällt, dass sie „anders“ sind.
Beschwerden der Eltern über Verweigerung des Schulbesuchs
An Grenzen stoßen sie erst dann, wenn sie außerhalb der Familie in staatliche Obhut kommen. Es beginnt mit dem Besuch des Kindergartens und setzt sich mit dem Schulbesuch fort. Erste negative Erfahrungen wie Ausgrenzung, Diskriminierung und Zurückhaltung von Mitmenschen werden gemacht, deren Auslöser die Erkrankung ist. Betroffene Eltern berichteten von Fällen, in denen Lehrer sie ersuchten, sich jederzeit während des Unterrichts vor der Schule im Auto bereitzuhalten, falls das Kind Unterstützung benötige. Auch sollen Lehrer ohne Rücksicht auf die Diabetes-Erkrankung Kindern verboten haben, während des Unterrichts die unbedingt notwendigen Essenseinheiten einzuhalten, da essen nur während der Pause erlaubt sei. Beschwerden von Eltern gingen bis hin zur Verweigerung des Kindergarten- und Schulbesuchs, weil man über zu wenig bzw. nicht qualifiziertes Personal verfüge. Mitschüler gehen mit Schulkollegen, die Medikamente einnehmen oder den Blutzuckerwert bestimmen müssen, in der Regel unbefangen um, aber nicht immer so die Lehrer: Sie sollen Kinder für einfache medizinische Verrichtungen mitunter in ein anderes Zimmer geschickt haben, damit sie den Unterricht nicht stören.
Natürlich soll aber auch betont werden, dass es sehr engagierte Lehrer gibt, die Schüler völlig vorurteilsfrei, ohne Angst, einen Fehler zu machen und ohne zu überlegen, wie weit ihre Lehrerpflichten gehen, unterstützen. Nicht zuletzt gilt es auch zu bedenken, dass die Lehrerausbildung für solche medizinischen Unterstützungsleistungen keine Grundlage bietet und bei allfälligen Fehlern eine Klage und in Folge die Heranziehung der Lehrer zur Schadenersatzleistung befürchtet wurde, obwohl kein einziger solcher Fall bekannt wurde.
Kinder brauchen aber oft gar keine Hilfe von außen, sondern es müssen durch Informationen an die Lehrer – als medizinische Laien - bloß die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sie ihre Krankheit selbst managen können. Diese Informationen sollten bereits in der Ausbildung zur Verfügung gestellt werden, um eine mögliche Hemmschwelle frühzeitig abzubauen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Sinnvoll wäre es auch, in jeder Schule einen oder einige Lehrer mit einer Art Ersthelferausbildung zu haben, damit diese einfache medizinische Tätigkeiten, die nach § 50a Ärztegesetz von Ärzten delegiert werden dürfen, durchführen können, wenn Kinder nicht mehr weiter wissen. Darüber hinaus bedarf es aber neben der schulärztlichen Betreuung zusätzlich medizinischer Ansprechpersonen für Lehrer und Schüler innerhalb der Schule. Ein System, das in Großbritannien bestens etabliert ist.
Zusammen mit dem Nationalratspräsidium hat die Volksanwaltschaft eine Enquete im Mai 2015 im Parlament veranstaltet, in der das Problem von mehreren Seiten – medizinisch, pflegerisch und rechtlich – beleuchtet wurde. Auch die Lehrervertretung war eingeladen, um sich in die Diskussion einzubringen.
Zusammengefasst knüpfte die Volksanwaltschaft folgende Forderungen an die gewonnenen Erkenntnisse: Medizinisches Ausbildungsmodul in der Lehrerausbildung, Information an Pädagogen über die medizinischen Fakten und juristischen Problemlagen, Rücksicht auf die Bedürfnisse chronisch kranker Kinder als (Lehrer-) Dienstpflicht ernst nehmen, Ausbildung und Einsatz speziell geschulter Ansprechpersonen in der Lehrerschaft und Etablierung eines „School-Nurse-Systems“, also von Gesundheits- und Krankenpflegepersonen mit pädiatrischem Wissen in den Schulen.
Der Lehrer haftet nicht mehr primär selbst
Wenngleich bei der Umsetzung dieser Forderungen noch „Spielraum nach oben“ erkennbar ist, hat die Initiative der Volksanwaltschaft bereits erste Früchte getragen: So wird im Zuge der Bildungsreform 2017 in das Schulunterrichtsgesetz eine Bestimmung eingefügt, dass gewisse medizinische Tätigkeiten durch Lehrer nun eindeutig als Ausübung von Dienstpflichten anerkannt werden. Passieren dabei Fehler, haftet nicht primär der Lehrer selbst, sondern der Staat als Dienstgeber im Wege der Amtshaftung. Dies bringt für alle Beteiligten Vorteile: Geschädigte sind nicht mehr dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Schädiger ausgesetzt, und Schädiger können nur mehr bei qualifiziertem Verschulden im Regresswege vom Dienstgeber belangt werden.